Produktangaben: Schutz und Schwierigkeiten der geografischen Herkunft
Schweizer Taschenmesser made in China? Dass das nicht geht, hat unlängst das Landgericht München I entschieden und der Herstellerin des „Schweizer Taschenmessers" Recht gegeben, die sich gegen Kennzeichen auf Taschenmessern aus China mit eindeutigem Bezug zur Schweiz gewandt hatte. Die Schweizer Flagge und die Angabe „Switzerland“ seien geografische Herkunftsangaben, deren guter Ruf durch die Herstellerin aus China ausgenutzt werde. Es ist eines von vielen Verfahren, in dem sich die „Schweizer Taschenmesser“ gegen Nachahmer zur Wehr setzen – nicht überall mit entsprechendem Erfolg. Auch in einem früheren, in den USA geführten Rechtsstreit ging es schon einmal um Taschenmesser made in China, die mit Schweizer Symbolen versehen waren. Hier unterlag die Herstellerin des Schweizer Taschenmessers Victorinox.
Die Entscheidung des LG München macht aber wieder einmal deutlich, dass bei Kennzeichnung und Bewerbung von Produkten nicht nur auf mögliche ältere Kennzeichenrechte Dritter zu achten ist, sondern ebenso auf die korrekten Angaben zur geografischen Herkunft. Dabei ist neben der Frage, ob durch die Aufmachung eines Produktes der gute Ruf einer geografischen Herkunftsbezeichnung ausgenutzt wird vor allem auch zu beachten, ob Konsumenten durch Angaben zur Herkunft eines Produktes, das in Wirklichkeit aus einem anderen Gebiet stammt, in die Irre geführt werden könnten. Aufgrund der vermehrt arbeitsteiligen Wirtschaft wird jedoch die eindeutige Bestimmung des Herkunftsortes zunehmend schwierig.
Rufausbeutung durch Taschenmesser made in China?
Die Herstellerin des „Schweizer Taschenmessers“ hatte sich gegen rote Taschenmesser mit Schweizer Flagge und dem Schriftzug „Switzerland“ bzw. „Swiss“ zur Wehr gesetzt, die nicht in der Schweiz, sondern in China produziert wurden. Die verwendeten Symbole und Schriftzüge stellen nach Auffassung des Landgerichtes geographische Herkunftsangaben dar, deren guter Ruf in unlauterer Weise durch die Herstellerin aus China ausgenutzt werde. Für die Annahme einer Rufausbeutung ausschlaggebend sei dabei, dass sich die Gestaltung der angegriffenen Produkte eng an die von Victorinox hergestellten „Schweizer Taschenmesser" anlehnt. Gerade diese „Schweizer Taschenmesser“ trügen aber entscheidend zum guten Ruf der geographischen Herkunftsangaben mit Bezug zur Schweiz bei. Ob die chinesischen Taschenmesser darüber hinaus auch dazu geeignet sind, die Verbraucher über den tatsächliche Herkunftsort in die Irre zu führen oder ob der Hinweis auf der Verpackung „Made in China“ zur Klarstellung ausreichen kann, ließ das Gericht offen.
Um diese Fragen ging es auch in einem schon vor längerem in den USA verhandelten Fall: Hier hatte sich das „Schweizer Taschenmesser“ ebenfalls gegen ein in China hergestelltes Taschenmesser mit der Bezeichnung „Swiss Army Knife“ in roter Farbe und mit Schweizer Kreuz gewandt. Der District Court stellte hierzu zunächst fest, dass es sich bei der Verwendung der Bezeichnung "Swiss Army Knife" um täuschende Werbung handele, da ein falscher Eindruck über die Eigenschaften, Qualitäten und die geographische Herkunft der chinesischen Messer erweckt werde. Das Urteil wurde durch den Court of Appeals jedoch teilweise wieder aufgehoben, der in der Bezeichnung „Swiss Army Knife" keine geografische Herkunftsangabe sah. Dass mit dieser Angabe geographische Assoziationen hervorgerufen würden, reiche dafür nicht aus und dürfe daher nicht mit der Angabe "Made in Switzerland" gleichgesetzt werden. Auch liege keine Täuschung über die Qualität vor. Da der Begriff "Swiss Army Knife" eben keine geographische Herkunftsbezeichnung sei, liege darin auch nicht allein deshalb ein Hinweis auf die hohe Qualität des Produktes, weil Konsumenten dabei an die hohe Qualität Schweizer Firmen und Schweizer Handwerker denken würden.
Die unterschiedliche Beurteilung der Fälle zeigt den schmalen Grat, der über die Einstufung als Herkunftsangabe mit entsprechend höheren Anforderungen an ihre Zulässigkeit oder bloße Produktaufmachung mit geografischer Assoziation entscheiden kann.
Werbung mit geografischer Herkunftsangabe trotz anderen Herstellungsorts?
Neben einer möglichen Rufausbeutung, die, wie im Taschenmesser-Fall durch die ungerechtfertigte Anlehnung an den guten Ruf einer geografischen Herkunftsangabe durch die Verwendung von hierauf hinweisenden Angaben oder Symbolen entstehen kann, sind Angaben zur geografischen Herkunft aber vor allem auch dann problematisch, wenn die Produkte bzw. Teile hiervon tatsächlich gar nicht aus dem Gebiet stammen, auf das sich die Herkunftsangabe bezieht.
Nach § 127 Abs. 1 MarkenG dürfen geographische Herkunftsangaben im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren benutzt werden, die nicht aus dem Gebiet oder Land stammen, das durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn hierdurch eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht. Dabei sind nicht diejenigen Fälle besonders schwer zu beurteilen, in denen das Produkt schon keine unmittelbaren Berührungspunkte zu dem angegebenen Herkunftsort hat. So wurde eine Irreführungsgefahr zum Beispiel für die Bezeichnung „Chiemseer“ für Bier angenommen, dessen Brauerei nicht am Chiemsee liegt (OLG München), für „Himalaya Salz“, das aus einem eigenständigen, deutlich niedrigeren Mittelgebirgszug abgebaut wird (OLG Köln) oder für die Angabe „Original Ettaler Kloster Glühwein“ für einen Glühwein, dessen Produktionsstätte nicht das Kloster Ettal ist (LG München I). Fragen stellen sich vielmehr dann, wenn einige der Produktionsschritte an anderen Orten stattfinden und das Endprodukt damit aus verschiedenen Bestandteilen unterschiedlicher räumlicher Herkunft besteht.
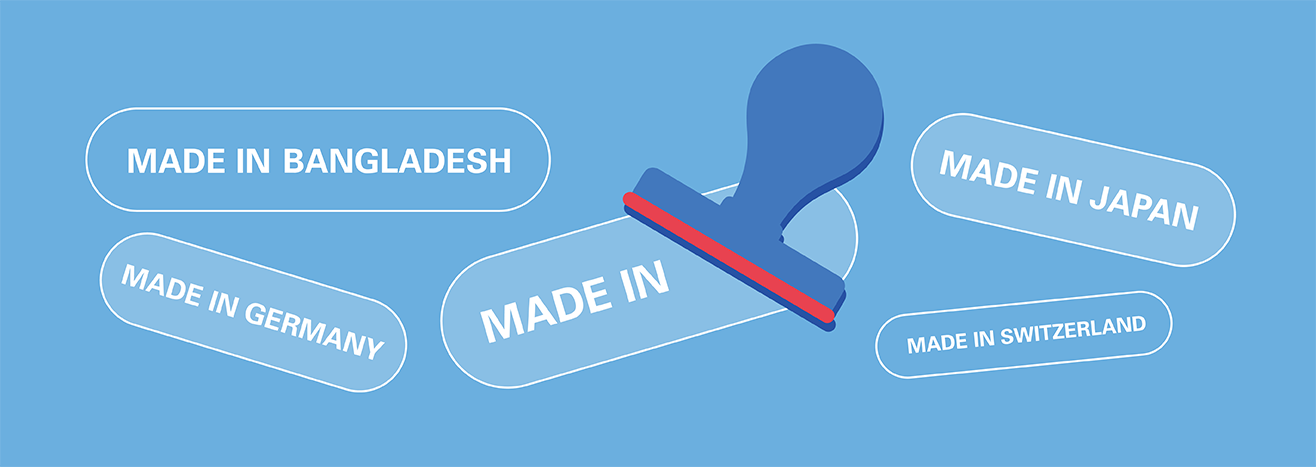
Wieviel des Herkunftsortes muss also in dem Produkt stecken, damit hierauf hingewiesen werden darf?
In einer Grundlagenentscheidung aus dem Jahr 1973 (GRUR 1973, 594 (595) – Ski-Sicherheitsbindung) hatte der BGH bereits festgestellt, dass eine Ware deutscher Herstellung entstammt, wenn die Eigenschaften oder Bestandteile der Ware, die in den Augen des Publikums deren Wert ausmachen, auf einer deutschen Leistung beruhen. Auch in der weiteren Rechtsprechung wurde immer wieder betont, dass es darauf ankommt, wo diejenigen Produktionsschritte stattgefunden haben, bei denen das Produkt seine qualitäts-bestimmenden Eigenschaften erhält.
Für die Frage, wann der Anteil der wesentlichen Produktionsschritte hoch genug ist, um einen Hinweis auf die geografische Herkunft etwa durch „Made in“-Angaben zu rechtfertigen, bieten die Zollvorschriften eine Orientierung. In Anlehnung an Art. 39, 40 i.V.m. Anhang 11 der DurchführungsVO zum Zollkodex soll ein Wertschöpfungsanteil von 45 % in Deutschland ausreichen, um die Herkunftsbezeichnung eines Produktes aus Deutschland zu rechtfertigen. Dieser Orientierungswert, den auch die Industrie- und Handelskammern als Wertgrenze für die Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ empfehlen, kann natürlich im Einzelfall auch deutlich geringer ausfallen.
Gleichzeitig kommt es darauf an, in welcher Weise auf die Herkunft hingewiesen wird. So urteilte das OLG Düsseldorf in seiner „Made in“-Entscheidung, dass die Angabe „Made in Germany“ für ein Besteckset, bei dem die Rohmesser in China hergestellt werden, das restliche Besteck und die weiteren Arbeitsschritte jedoch in Deutschland, wettbewerbsrechtlich unzulässig sei, da durch die besondere Herausstellung des Herstellungslandes die Erwartung geweckt werde, sämtliche Teile würden in Deutschland hergestellt. Dagegen war Werbung mit „Made in Germany“ für einen Schmiedekolben aus Sicht des OLG Köln nicht zu beanstanden. Hier wurde zwar auch ein Schmiedevorgang im Ausland vorgenommen, die Arbeitsschritte für die wertbildenden Eigenschaften - neben dem Material auch das Know-How und die gesamte technische Verarbeitung -, seien jedoch in Deutschland vorgenommen worden.
Bei der rechtlichen Beurteilung zu berücksichtigen sind schließlich auch Angaben, die darüber aufklären sollen, dass die geographische Herkunftsangabe nicht als Angabe über den Herstellungsort zu verstehen ist (sog. entlokalisierende Zusätze, zum Beispiel: „Mark Brandenburg-Milch, abgefüllt in Köln, vgl. OLG Stuttgart). Allerdings führen derartige Angaben, für die strenge Anforderungen gelten, nicht in jedem Fall aus einer Irreführungsgefahr hinaus. So dürfen sie optisch nicht gegenüber der geografischen Herkunftsangabe in den Hintergrund treten, müssen also in ausreichender Größe und sichtbarer Platzierung angebracht sein und dem Verbraucher dadurch quasi ins Auge springen.
Fazit
Werden mit den Produktangaben oder der Aufmachung nicht bloße geographische Assoziationen hervorgerufen, sondern auf die geografische Herkunft hingewiesen, so muss dort jedenfalls ein relevanter Anteil der Produktionsschritte erfolgen, die dem Produkt die qualitätsbestimmenden Eigenschaften verleihen.
Als Indiz kann dabei ein Wertschöpfungsanteil von 45% in dem Gebiet herangezogen werden, auf das die geografische Herkunftsangabe verweist. In der Regel vernachlässigt werden können im Falle von „Made in“-Angaben die Herkunft der Rohstoffe ebenso wie zeitlich vor- und nachgelagerte Arbeitsschritte wie die Planung, das Design oder die Endmontage.
Die korrekte Herkunftsbezeichnung ist dabei aber nicht nur zur Vermeidung einer Irreführung der Verbraucher relevant. Produktangaben und/oder -aufmachung dürfen sich auch nicht an den guten Ruf einer geografischen Herkunftsangabe anlehnen, ohne selbst diese Herkunftsangabe nach den o.g. Kriterien für sich beanspruchen zu können.
Dabei ist zu unterscheiden, ob die jeweilige Angabe tatsächlich auf die geografische Herkunft hinweist (so etwa bejaht für die Schweizer Flagge und den Schriftzug „Switzerland“) oder nur ein gewisser Bezug zu einem Ort oder Land hergestellt wird, der zwar geografische Assoziationen weckt, für das Produkt aber nicht zur Folge hat, dass die wesentlichen wertbildenden Produktionsschritte auch dort stattfinden müssen.
Ein Beitrag von
